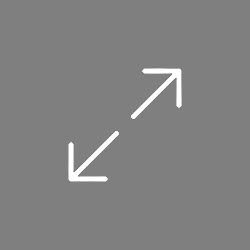Weihnachtsgeschichten: »Unvergessene Weihnachten«, Band 1, Zeitgut Verlag Berlin
»Der Kaufladen« von Elisabeth Kirch Schuster
Daß ich Weihnachten mit allem Drumherum jedes Jahr aufs Neue so intensiv erlebe, liegt vielleicht daran, daß ich am Heiligabend geboren bin. Wenn sich auch im Laufe der Zeit so vieles rund um das Fest verändert hat, bleibt doch das Wichtigste, der Sinn der Weihnacht, erhalten: Gott selbst ist aus Liebe zu uns in dieser Nacht Mensch geworden, und die Menschen sollten es ihm gleichtun.
Wann sich das Jahr der Weihnachtszeit zuneigte, erkannten wir damals an ganz anderen Vorzeichen als heute. Waren die Runkelrüben im Keller und die Stoppelrüben abgeerntet, ein Teil des Getreides gedroschen und der Weißkohl im Steintopf zu Sauerkraut eingelegt, war schließlich das Schwein geschlachtet, dann – ja, dann konnte Weihnachten werden.
#Strümpfe, #Socken, #Handschuhe und Schals wurden gestrickt, und am Abend im Dunkeln wurde der Rosenkranz gebetet. Und Mama sagte fast täglich: »Kinder, wenn ihr nicht brav seid, bekommt ihr nichts vom #Christkind.«
In einem Jahr, ich war 7 Jahre alt und meine Schwester Martha neun, wünschten wir uns zu Weihnachten zusammen einen Kaufladen. Wir hatten schon immer gern Kaufen und Verkaufen gespielt, mit allen Dingen, die es in unserem Haushalt gab. Bezahlt wurde mit Erbsen und Bohnen in verschiedenen Größen und Farben. Wenn wir fleißig den Rosenkranz beteten, so hieß es, würde sich unser Wunsch vielleicht erfüllen. Das wollten wir gern tun.
Nun schliefen wir zwar gemeinsam in einem breiten Bett, waren aber durch unsere Lebhaftigkeit am Tage abends so müde, daß wir viel zu schnell einschliefen. Unsere große Schwester dagegen blieb noch lange wach und betete viele Male. Da sannen wir auf einen Ausweg: Wir nahmen jeder eine Stecknadel mit ins Bett, und sobald eine von Müdigkeit übermannt wurde, pikste die andere sie mit der Nadel. So hielten wir uns gegenseitig munter und waren ganz stolz, bis Weihnachten mehr Rosenkränze geschafft zu haben als unsere ältere Schwester. Also hofften wir in kindlichem Glauben auf den Kaufladen vom Christkind.
Weihnachtsmorgen. Bescherung war erst nach der Christmette, die meistens morgens, ganz in der Früh, um 5 Uhr in unserer Pfarrkirche stattfand. Papa und Mama sangen mit uns gemeinsam ein Lied, dann machten wir uns als erstes über unseren bunten Teller her: Blankgeputzte Äpfel, Nüsse, selbstgebackene Plätzchen und ein Weckmann. Später gab es auch schon mal eine Tafel Schokolade oder eine Apfelsine, die wir beide uns teilen mußten. Dann sahen wir uns unsere Geschenke an. Hausschuhe hatten wir bekommen, und in jedem Paar lag vorn ein Rosenkranz aus bunten Glasperlen drin. Wir Mädchen hatten sogar alle drei ein neues, gleiches Kleid bekommen, darüber freuten wir uns sehr.
Plötzlich entdeckten wir zwischen unseren Tellern eine Kaufladenwaage mit niedlichen Gewichtssteinen. Suchend sahen wir uns um, denn wir glaubten, wo eine Waage ist, müßte auch ein Kaufladen sein. Wir schauten in alle Ecken: unter den Tisch, unter die Bank, hinter den Herd und neben den Schrank. Nichts, und wieder nichts!
Papa war gerade in den Stall gegangen, um die Tiere zu füttern, Mama befand sich im Schlafzimmer, um sich vom Kirchgang umzuziehen. Martha und ich liefen zu ihr hinein und bestürmten sie mit der Frage, wohin das Christkind unseren Kaufladen gestellt hätte. Da sagte sie fast tonlos:
»Es reichte nicht für einen Kaufladen.«
Nun weinten wir beide los, denn wir dachten, sie meinte, all die Rosenkränze hätten nicht gereicht. Zu spät bemerkten wir, daß unsere Mama nur mühsam ein Schluchzen unterdrücken konnte.
In diesem Moment kam Papa hinzu. Mit rauher Stimme sagte er: »Jetzt hilft alles nichts, wir müssen es euch sagen. Das echte Christkind, den Gott, der für uns Mensch geworden ist, das gibt es, und dadurch werden wir alle reich beschenkt, aber das versteht ihr noch nicht richtig. Jedenfalls, die Sachen auf dem Weihnachtstisch, die müssen wir kaufen, und dafür müssen Mama und ich hart arbeiten und sparsam leben; und für viele notwendige Anschaffungen reicht das Geld nicht. – Eigentlich wollte ich für Mama ein neues Kleid kaufen, stattdessen hat sie aus dem Stoff für euch Mädchen die neuen Kleider nähen lassen!«
Wir waren tief beschämt. Mit Kartons und allerhand Krimskrams spielten wir weiter Kauffrauen, natürlich nicht ohne die Waage vom Christkind.
Zwar waren wir um eine Illusion ärmer, aber es fiel uns von da an leichter, unsere Wünsche den gegebenen Umständen anzupassen. Und wir bemühten uns, mit selbstgefertigten Handarbeiten auch unsere Eltern zu beschenken.
»Retter in der Not« von Hildegard Brandt
Berlin Reinickendorf, 1943. Auf #Weihnachten freuten wir 6 Geschwister uns immer ganz besonders. Große Gaben hatten wir nicht zu erwarten, aber es gab immer einen Weihnachtsbaum, einen bunten Teller, etwas Praktisches und ein unerwartetes kleines Geschenk. Meine kleineren Schwestern träumten stets von allerlei schönen Dingen, die, obwohl wir schon im 4. Kriegsjahr waren, noch in den #Spielwaren Geschäften ausgestellt wurden. Diesmal hatten sie niedliche Püppchen gesehen, die ihnen der #Weihnachtsmann bringen sollte.
Da das Geld immer sehr knapp war, kaufte meine Mutter oft schon im Herbst einige Kleinigkeiten für den Weihnachtstisch. Sie fing auch früh an, Nüsse, Marzipan und andere Süßigkeiten für den bunten Teller zu sammeln.
Eines Tages stellte Schwester Edith fest, daß die mittlere Schublade der großen Kommode verschlossen war. Nun ging die Raterei los, jede wüßte zu gerne, was da wohl schon versteckt sei. Ich war damals elf Jahre alt und nicht weniger neugierig als die Kleinen. Als meine Eltern einmal nicht zu Hause waren, überlegten wir, ob man nicht die obere nicht verschlossene Lade herausziehen könnte, um einen Blick in die untere zu werfen. Es war schwierig, das klobige Ding überhaupt zu bewegen. Schließlich gelang es uns, den Kasten auf den Fußboden zu bugsieren. Und nun konnte man sogar in die andere hineinfassen!
Große Freude bei uns allen, denn darin lagen vier Püppchen, wie sie sich meine Schwestern wünschten. Jede hatte ein andersfarbiges Kleid an. Trudchen, Erika, Elfriede und Mohrchen entschieden sich gleich für eine bestimmte Farbe. Sie wurden gedrückt und geknutscht und keine wollte das Püppchen wieder hergeben. Aber das ging ja nicht, die Zeit verstrich, und wir mußten ja die alte Ordnung wiederherstellen. Das war jedoch leichter gedacht als getan. Der schreckliche Kasten war so schwer, daß er sich kaum bewegen ließ. Und nun klingelte es auch noch!
Vor der Tür stand unser Nachbar, der bei uns in der Residenzstraße das wichtige Amt eines Blockwartes bekleidete. So richtig leise war es bei uns sehr selten, aber diesmal mußten wir wohl übertrieben haben, daß es den Ordnungshüter auf den Plan brachte. Er kannte alles und jeden im Haus, außergewöhnliche Dinge blieben ihm nicht verborgen. Mit den Worten: »Ist was passiert?«, schritt er schnurstracks ins Zimmer und übersah die schwierige Situation sofort.
Ohne auf unsere Erklärungsversuche einzugehen, wuchtete er die Schublade in die Höhe und schob sie wieder in die Kommode! Wir hätten ihm jetzt vor lauter Dankbarkeit alles versprochen, mußten ihn aber doch inständig bitten, unseren Eltern nichts zu verraten. Wir haben nie erfahren, ob er dichtgehalten hat rausgekommen ist letzten Endes doch alles.
Endlich war Weihnachten. Das Wohnzimmer, meistens etwas kühl, war am Heiligen Abend gut geheizt, der Baum wunderschön geschmückt. Kugeln und Lametta wurden von Jahr zu Jahr aufgehoben, und aus Resten hatten wir sogar Kerzen gegossen. Nach der Bescherung saß jedes Kind auf dem ihm zugewiesenen Platz am Tisch, als sich plötzlich ein fürchterliches Geschrei erhob. Die Kleinen zankten und schrien: »Ich will rosa!«, »Ich will grün!« und gerieten sich fast in die Haare.
Unsere Eltern guckten erst etwas verstört, behielten zum Glück aber die Nerven und schlugen dann vor, sie sollten doch die Puppen tauschen. Nun kehrte Frieden ein, Weihnachtslieder wurden gesungen, Gedichte aufgesagt und schon von den Köstlichkeiten des bunten Tellers genascht.
Als ich meine Mutter viel später einmal fragte, wieso sie bei dem Durcheinander Weihnachten nicht ausgerastet sei, meinte sie, längst hätte sie gemerkt, daß etwas im Busche war. Die Kinder bemühten sich ein paar Tage unerwartet freundlich miteinander umzugehen und auch artig zu sein. Der Clou war dann, daß sie beim Einteilen der Süßigkeiten für die Bunten Teller gemerkt hatte, daß eine einem Marzipan Schweinchen den Kopf abgebissen hatte.
»Die Annonce« von Georg Günther
Magdeburg/Elbe, Sachsen Anhalt, Advent 1945. Es war in der Adventszeit des Jahres 1945. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges war unsere fünfköpfige Familie endlich wieder beisammen. Kurz vor Kriegsende in unserer Heimatstadt Magdeburg total ausgebombt, bestand unser Hab und Gut nur noch aus zwei geretteten Koffern mit Kleidungsstücken. Wir waren sehr beengt in einer kleinen Wohnung vorübergehend untergebracht. Die eigentliche Mieterin war mit ihrem Kind während der Kriegszeit evakuiert worden und wohnte auf dem Lande. Natürlich wollte sie wieder zurückkommen, aber dies ging erst, nachdem wir etwas anderes gefunden hatten. Das Jahresende mußten wir noch dort verbringen.
Mein Bruder war, wenn auch verwundet, aus der Kriegsgefangenschaft heimgekehrt; auch meine Schwester kam von der Seefahrt zurück. So sahen wir dem bevorstehenden Weihnachtsfest mit Dankbarkeit und Freude entgegen.
Dieses Fest sollte nun in unserer Familie nach all den Erlebnissen und Entbehrungen etwas Besonderes werden. Es sollte sich auch äußerlich, durch kleine Geschenke und Überraschungen, abheben von den anderen Tagen. Das war jedoch 1945 sehr schwer, es gab fast nichts. Da mußten die Erwachsenen verzichten. Meine Erwartungen ich war damals 12 Jahre alt sollten jedoch nicht gänzlich enttäuscht werden.
Meine Schwester hatte die Idee, eine Annonce aufzugeben. Wo und wie aber?
Eine Zeitung erschien noch nicht wieder. Anstelle dessen wurden Bretterplanken und Mauern genutzt, um auf selbstverfaßten Zetteln Such oder Tauschwünsche zu veröffentlichen. Und so schrieb meine Schwester einen derartigen Zettel mit folgendem Text: »Biete Lebensnotwendiges, suche Spielzeug für 12jährigen Jungen und #Kaffee.«
Mit letzterem gedachte sie, auch meiner Mutter eine Freude zu bereiten. Mit dem Zettel, Nägeln und Hammer bewaffnet machte sich meine Schwester also auf den Weg zu einer Hausruine an einer Straßenecke, wo sie die Annonce an eine Holzplanke nagelte. Davor stand immer eine Schar Menschen und las die Tauschangebote.
Ich erfuhr von dieser Sache natürlich nichts. Wie mir meine Schwester später erzählte, ist sie täglich zu der Annoncen Planke gegangen, immer mit der Hoffnung auf ein Angebot. Dann endlich, ein paar Tage vor Heiligabend, stand eine Adresse unter der Anzeige. Auf die Nachfrage nach Spielzeug, meldete sich ein junges Ehepaar. Der Mann besaß noch einiges aus seiner Kinderzeit, das er gern gegen Lebensmittel eintauschen wollte. Den Leuten konnte mit etwas Fleisch geholfen werden, und meine Schwester erhielt dafür das gesuchte Spielzeug für ihren kleinen Bruder.
Auch für den Kaffee bekam sie ein Angebot. Es meldete sich eine alte Frau. Meine Schwester ging am Tag vor Heiligabend zu ihr und nahm ebenfalls etwas Fleisch mit, denn wir hatten durch eine Schlachtung, bei der mein Bruder half, ein größeres Stück als Lohn bekommen. Die Vorfreude meiner Schwester war so groß, daß sie den weiten Weg schnell zu Fuß zurücklegte. Dort angekommen, gab es aber eine Enttäuschung für sie: Die Frau bot nur Malzkaffee!
Dies meinte sie mit dem Wort Kaffee. Also ein Mißverständnis.
Meine Schwester entschloß sich, das Mitgebrachte dort zu lassen, den Malzkaffee auch. Als Gegenleistung entdeckte sie bei der alten Frau ein paar Freudentränen, und das war Dank genug. Es war wie ein Licht, das in schwerer Zeit angezündet war. Ihr Weihnachtsbraten war gesichert. Zu dem Bohnenkaffee sind die Frauen am Ende doch noch gekommen. Wie weiß ich nicht.
Was denkt wohl ein Kind, wenn es keinen #Weihnachtsbaum zu Weihnachten geben soll?
Ich drießelte meinen Vater schon lange vor dem Fest nach einem Weihnachtsbaum. Zu kaufen gab es keinen, das wußte ich auch. Aber was sollte werden?
Ich konnte mir jetzt, wo wir doch alle wieder zusammen waren, Weihnachten ohne Baum einfach nicht vorstellen.
Mein Vater wußte Rat: »Dann gehe ich in den #Wald schließlich war er mal Familienbesitz und hole selber eine #Fichte!«
Sprach's und machte sich am anderen Morgen früh auf den Weg. Der Wald lag 25 Kilometer von uns entfernt, in östlicher Richtung über der Elbe. Die Brücken waren gesprengt, nur eine Holzbrücke war gebaut worden. Eisenbahnzüge verkehrten darüber jedoch nicht. Also mußte Vater zu Fuß, etwa 2 ½ Stunden bis zum nächsten Bahnhof auf der anderen Elbseite gehen.
Da fuhr auch kaum ein Zug. Kohlen für die Lokomotiven waren sehr knapp. Schließlich ging es doch los, kalt und voll waren die Wagen. Endlich erreichte der Zug den Ort, wo der Wald lag. Bäume gab es dort genug, so daß die Auswahl nicht schwerfiel, und er einen Weihnachtsbaum selbst schlagen konnte. Der Rückweg war genauso strapaziös wie der Hinweg. Am anderen Tag erst traf der Vater wieder zu Hause ein und berichtete uns von seinen Erlebnissen, aber es hatte sich gelohnt.
Endlich wieder beisammen: meine Eltern, meine Geschwister und ich Weihnachten 1945 in unserer Heimatstadt #Magdeburg.
Am Heiligen Abend stand der #Baum mit selbstgegossenen #Kerzen und selbstgefertigtem #Christbaumschmuck im #Wohnzimmer. Darunter lagen für mich 3 Kinderbücher und ein Fußballspiel.
So konnte die sich nach dem Zweiten Weltkrieg wiedergefundene Familie ein glückliches Weihnachtsfest feiern. Meine Schwester freute sich über die gelungene Überraschung für den kleinen Bruder und war überglücklich. In der heutigen Zeit bedarf es dazu weitaus größerer Geschenke die Zeit ist eine andere.
»Das Tretauto« von Hans Engels
Köln, Nordrhein Westfalen, Dezember 1946. Es war noch zu der Zeit, als man das, was man gerne besitzen wollte, selber machen mußte. Man konnte es nicht kaufen; sei es, daß man kein Geld hatte, sei es, daß es überhaupt nicht käuflich zu erwerben war. Ein solches »Es« war ein blaues #Tretauto.
Mein Vater hatte es gebaut für meinen älteren Bruder. »Gebaut« ist eigentlich nicht das richtige Wort. Er schuf es vielmehr, so wie Gott die Welt erschaffen hatte – aus dem Nichts.
Denn es war ja nichts da, oder richtiger, fast nichts. Und aus dem wenigen, das da war, entstanden unter den Händen meines Vaters die wunderbarsten Dinge.
Er war dann fern jeder Hektik, die Ruhe selbst, eine geheimnisvolle, aber auch bergende Ruhe, die uns in seinen Bann zog. Sehr zum Leidwesen der Mutter, die diese himmlische Ruhe jedesmal aus der Fassung brachte: Wie konnte ein Mensch nur eine solche Geduld haben!
Während dieses schöpferischen Tuns kam nicht ein unbeherrschtes oder gar böses Wort von seinen Lippen. Ich glaube, daß sein Wesen mich damals anrührte, denn noch heute steht für mich fest: Alle guten Dinge gedeihen in der Stille, sie benötigen Geduld und Güte und nicht der großen Worte. Leider entschwindet diese Weisheit mir allzuoft, und ich laufe Gefahr, mir selber untreu zu werden.
Das Tretauto wuchs also heran, bis es vollständig war, bis es gleichsam geboren war – ein Wunderwerk an Eleganz und technischer Raffinesse. Und man weiß nicht, wer mehr erstrahlte, ja wessen Augen mehr glänzten, die des Erbauers oder die des Fahrers.
Das blaue Tretauto mit meinem Bruder 1942. Er war damals vier Jahre alt und starb im März 1945 im Alter von 7 Jahren. Doch lange währte das Glück nicht. Vater mußte an die Front. Und als er wiederkam, war mein Bruder gestorben.
Es dauerte lange, bis mein Vater den Schmerz überwunden hatte. Ob er je da hinausfand, weiß ich nicht. Das Schweigen war ihm immer schon sein Zuhause gewesen, und er öffnete nur ganz selten die Tür zu seinem Innern einen Spalt und ließ einen Blick zu. Und wenn es einmal geschah, dann war es weniger ein Wort als vielmehr ein Blick, ein Lächeln oder auch nur ein tiefer Atemzug oder eine Gebärde.
Aber nun stand dieses Wunderwerk von einem Auto im Keller. Doch aller Glanz war von ihm gewichen. Staub bedeckte den glatten Lack, und an den Rädern klebte noch der Schmutz von seiner letzten Fahrt. Einmal trat ich in den Keller und erschrak ein wenig, denn Vater stand an seinem Werk, eine ganze Weile.
Schließlich strich er mit seiner linken Hand über den Lack, ja er streichelte das Gefährt, und die schöne blaue Farbe leuchtete, von der Staubschicht befreit, und zeigte erst jetzt ihre glänzende Schönheit.
Als er mich bemerkte, blieb er unsicher stehen. Schließlich ging er in die Knie und drückte mich, der ich näher gekommen war, an seine Brust. Ein kühler Tropfen fiel auf meine Hand. Wir redeten nicht miteinander, und auch später hätte jedes Wort unser Geheimnis zerstört.
Es ging gerade auf Weihnachten zu, und insgeheim wünschte ich mir, Besitzer des Tretautos zu werden; aber ich wagte ja nichts davon zu sagen. Es wäre wohl ein besonders günstiges Geschenk für mich. Das Christkind brauchte jedenfalls kein Geld auszugeben, das Auto war ja schon da.
Und tatsächlich, eines Abends war das Auto weg. Aber ich brauchte nur dem Duft der frischen Farbe nachzugehen. Blitzeblank stand es in einem Bretterverschlag, die Stoßstangen waren neu gestrichen, mit schwarzer Farbe und die Radfelgen mit gelber. Ich war fest davon überzeugt: Das war mein Weihnachtsgeschenk.
Wenige Tage vor Weihnachten hielt ein #Lkw vor unserem Haus, damals ein nicht alltägliches Ereignis, aber an diesem Abend ein wunderbares zugleich.
Der Lkw brachte Kartoffeln. 6 Säcke voll Kartoffeln! 6 Zentner! Eine herrliche Sache. Wir konnten zu Weihnachten Kartoffeln essen!
Die Männer schafften die Kartoffelsäcke in den Keller, einen Sack nach dem anderen. Meinen Vater sah ich nicht in der hereinbrechenden Dunkelheit.
Und dann trugen die Männer das blaue Tretauto aus dem Keller, über den Hof, zur Straße und schoben es in den dunklen Laderaum.
Das Auto verschwand.
Ich habe Vater an diesem Abend nicht mehr gesehen, erst am nächsten Abend, als er von der Arbeit kam. Mutter hatte Kartoffeln gekocht und dann mit Zwiebeln gedämpft. Dies mußte mit Wasser geschehen, denn Fett gab es keines.
Aber an diesem Abend schmeckten die Kartoffeln nicht; und das lag nicht nur daran, daß Mutter sie hatte anbrennen lassen.
Später, ich glaube, es war zwei oder drei Jahre danach, baute Vater wieder ein Tretauto, ein grünes mit roten Kotflügeln. Aber es fuhr nicht so gut wie das blaue, und das war keine Einbildung!
»Mein Weihnachtswunsch: ein Vater« von Ernst Haß
Hamburg Wilhelmsburg, 7. Mai – Heiligabend 1923. In Hamburg Wilhelmsburg, am Obergeorgswerderdeich Nummer 9, bin ich aufgewachsen. Das Haus, das wir bewohnten, war eine Kate mit Strohdach. Man nannte diese Fachwerkhäuser auch Häuslings oder Kötnerhaus. Wir waren zu Hause zwei Brüder, mein Bruder August, Audi genannt, 1914 und ich, 1913 geboren. Alle Kinder bei uns am Deich hatten einen Vater, nur wir nicht. Ich litt sehr darunter und fragte: »Mutti, warum haben wir keinen Vater?«
Mutter sah mich mit großen Augen an, aber eine Antwort bekam ich nicht. Manchmal weinte sie, wenn ich wieder davon anfing. Als ich gut 6 Jahre alt war, erzählte unsere Mutter endlich, warum wir keinen Vater hatten. Unser Vater war bei der Kriegsmarine. Sein Schiff ging 1917 unter, und dabei ist er ertrunken. »So, Jungens, nun wißt ihr, warum ihr keinen Vater habt«, endete sie. Dabei kamen ihr die Tränen, und sie lief ins Schlafzimmer, um allein zu sein.
Es hat lange gedauert, bis ich dies alles begriff. Ich ging zu Mutter ins Schlafzimmer, umarmte sie und weinte mit ihr um unseren Vater. Dann lief ich aus dem Haus, setzte mich am Deich nieder und weinte weiter. Ich verfluchte diesen Krieg, der uns den Vater genommen hatte.
Am 7. Mai 1923 wurde ich zehn Jahre alt. An diesem Tag sagte ich zu Mutter: »Ich wünsche mir zu Weihnachten einen Vater!«
Mein Bruder wollte lieber eine Eisenbahn haben. Ich konnte ihn aber umstimmen: Er wollte nun zu Weihnachten auch einen Vater haben. Wir umarmten unsere Mutti und versprachen, daß wir ihr keinen Kummer mehr bereiten wollten. Normalerweise stellten wir jeden Augenblick etwas an, und nicht immer ging es gut aus. Unsere Mutter konnte uns kaum mehr in Schach halten, eine feste Hand mußte her.
Als Audi und ich eines Tages von der Schule nach Hause kamen und den Deich hinunterliefen, hörten wir unsere Mutter singen. Das Stubenfenster war offen. Mein Bruder und ich lauschten am Fenster. Wir hatten unsere Mutter noch nie in dieser Art singen gehört. Was hat das zu bedeuten?
Schließlich gingen wir hinein, fielen Mutter um den Hals und schmusten mit ihr. »Mutti, du kannst aber schön singen, das haben wir gar nicht gewußt!«
Unsere Mutter schmunzelte und meinte nur: »Es hat auch seinen guten Grund!« Aber verraten hat sie uns nichts. Wir brauchten nicht lange zu bitten, dann sang sie uns abends mit ihrer wunderschönen Sopranstimme in den Schlaf. Mein Lieblingslied war »Stolzenfels am Rhein«, weil darin ein gefallener Soldat vorkam. Ich mochte auch das Lied vom Fremdenlegionär, der in maurischer Wüste gefangen war.
Unsere Mutter veränderte sich in dieser Zeit. Sie lief neuerdings immer dem Postboten entgegen. Wenn er mit einem Brief für sie kam, war sie glücklich und hat ihn sofort gelesen. Hinterher sang sie den ganzen Nachmittag wie eine Nachtigall.
Der Monat Dezember rückte näher, es ging auf Weihnachten zu. Mutter fragte uns Jungen: »Was wünscht ihr Euch zum Weihnachtsfest?«
Mein Bruder sagte nun doch wieder, daß er sich eine #Eisenbahn wünsche. Als ich an der Reihe war, antwortete ich: »Mutter, was ich mir wünsche, weißt du schon.«
»Ja, Jungens«, sagte Mutter, »dann wollen wir mal sehen!«
Endlich war Heiligabend. Morgens durften wir Jungen den #Weihnachtsbaum schmücken. Mit Buntpapier und Kartoffelmehl, aus dem wir Kleister anrührten, hatten wir Ketten angefertigt und in den #Tannenbaum hineingehängt. Er sah schön aus! Mutter lobte uns und freute sich. Wir waren stolz auf unser Werk. Dann mußte sie noch einmal schnell weg, um in Niedergeorgswerder etwas einzukaufen.
Lange dauerte es, bis sie völlig außer Atem wieder nach Hause kam. Es wurde schon dunkel. Immer wieder sahen mein Bruder und ich den Deich hinauf – aber der Weihnachtsmann kam und kam nicht, es war nicht mehr auszuhalten!
Mutter meinte, daß der Weihnachtsmann nun bestimmt bald käme. Er hätte soviel zu tun hat, daß er gar nicht all die vielen braven Kinder besuchen könne. Bei uns wollte er aber auf jeden Fall vorbeikommen, wir seien ja artig gewesen, was wir auch hoch und heilig versprochen hatten. Wir hatten am Heiligtag wirklich nichts ausgefressen.
In dem Augenblick, als Mutter plötzlich aufstand und die vier Lichter am Baum anzündete, wummerte es an der Haustür. Mein Bruder bekam nun doch Angst und versteckte sich blitzschnell hinter dem Sofa. Mutter sah mich mit ihren großen Augen an und sagte: »Erni, mein Junge, dann laß mal dein Weihnachten herein!«
Sie hätten sehen sollen, wie schnell ich zur Tür flitzte und sie aufriß!
Draußen stand aber nicht der Knecht Ruprecht, sondern ein großer Mann, der einen Seesack auf dem Rücken trug. Mutter stand hinter mir und forderte mich auf: »Laß ihn man herein!« und gab dem Mann einen Kuß.
Unglaublich – mein Weihnachtswunsch war in Erfüllung gegangen: Dieser große Mann wurde unser neuer Vater!
Wir waren glücklich, denn nun hatten auch wir endlich wieder einen Papa, so wie alle Kinder bei uns am Deich. War das ein Weihnachten! – das schönste Weihnachtsfest, das ich je zu Hause erleben durfte.
»Später Besuch« von Eckhard Müller
Oberholz bei Much, Rhein Sieg Kreis im Bergischen Land, Dezember 1945. Es war Anfang Dezember 1945. Der Zweite Weltkrieg hatte sein Ende gefunden. Seit einem halben Jahr schwiegen die Waffen. Wir erwarteten das erste friedliche Weihnachtsfest seit 6 Jahren.
Das Leben hatte sich zunehmend normalisiert. Obwohl die Menschen in unserer ländlichen Gegend nicht in so hohem Maße unter dem Bombenterror zu leiden brauchten wie die Menschen in den Städten, war auch hier der Kriegsschrecken nicht spurlos vorübergegangen. Nun hieß es, zusammenrücken, denn der Strom von #Flüchtlingen und #Obdachlosen aus den #Ostgebieten und aus den Großstädten hielt an. Wer noch ein Zimmer oder eine Kammer in seinem Hause zur Verfügung stellen konnte, nahm eine Flüchtlingsfamilie bei sich auf. Es gab eine für heutige Verhältnisse unvorstellbare Solidarität. Das wenige, das man selber noch besaß, wurde geteilt mit denen, die alles verloren hatten.
Unser kleines Fachwerkhaus, das ich mit meinen Eltern und mit meiner Großmutter bewohnte, teilten wir seit den letzten Kriegstagen mit einem älteren Ehepaar. Es waren entfernte Verwandte, und sie hatten in einer Bombennacht ihre ganze Habe verloren. Nun waren sie froh, bei uns wenigstens wieder ein Dach über dem Kopf gefunden zu haben.
Die Militärregierung der Siegermächte hatte die zivile Verwaltung in ihre Hand genommen und somit Gesetz und Ordnung wiederhergestellt. Trotzdem waren die Zeiten noch sehr unruhig. Immer wieder machten umherstreunende Banden von sich reden. Es entstanden die wildesten Gerüchte. Man hörte von Greueltaten auch aus einigen Dörfern in unserer Gemeinde. Denn der Schutz des Gesetzes war noch nicht überall gewährleistet.
Diese umherziehenden Gruppen setzten sich zum großen Teil aus ehemaligen Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern aus Osteuropa zusammen. Nach Wiedererlangung ihrer Freiheit waren viele von ihnen nicht mehr gewillt oder in der Lage, in ihre Heimat zurückzukehren. Was man ihnen nicht freiwillig gab, nahmen sie sich mit Gewalt. Dabei kam es auch verschiedentlich zu Übergriffen und Racheakten gegenüber ihren früheren Unterdrückern. Nach Einbruch der Dunkelheit war es rat sam, Fenster und Türen gut zu verschließen. Wer draußen noch irgendeine Arbeit zu verrichten hatte, trug Sorge, sich nicht allzuweit von den schützenden Häusern zu entfernen.
Es war an einem solchen Abend in der Vorweihnachtszeit, ich glaube, es war am Abend des zweiten Advent. Meine Eltern waren eben mit der Stallarbeit fertiggeworden und wir schickten uns an, das Abendbrot zu essen, als plötzlich an unsere Haustür geklopft wurde. Mein Vater begab sich nach draußen, um nachzuschauen. Neugierig gesellte ich mich zu ihm. Ich war damals 9 Jahre alt.
Da stand in der Dunkelheit ein gutes halbes Dutzend Männer. In gebrochenem Deutsch baten sie um ein Quartier für die Nacht.
Zögernd ließ mein Vater sie eintreten. Nachdem sie in unserer Wohnstube Platz genommen hatten, konnten wir sie im Scheine der Lampe näher betrachten. Sehr vertrauenerweckend sahen sie nicht aus. Das Leben auf der Landstraße hatte sie gezeichnet.
Während meine Mutter das Abendbrot zubereitete, versuchte mein Vater etwas über das Schicksal der Männer zu erfahren. Nach der einfachen, mit wenigen Mitteln zubereiteten, aber kräftigen #Mahlzeit wurde beratschlagt, wie und wo man die Männer für die Nacht unterbringen könnte.
Im Hause selber war es, nicht zuletzt durch unsere Verwandten als neue Mitbewohner, ziemlich eng geworden. Also blieb nur noch die Scheune. Im Scheunenanbau befand sich der Holzschuppen, dort lagerte auch das Heu als Wintervorrat für unsere beiden Kühe. Hier im Heu richteten nun meine Eltern mit allerlei Decken und alten Mänteln ein warmes und bequemes Nachtlager her. Unsere alte Petroleumlam pe sorgte für die nötige Helligkeit.
Kurz vor Schlafenszeit entschloß sich mein Vater zu einem »Kontrollgang«, wie er sich ausdrückte. Es ließ ihm nämlich keine Ruhe, ob sich unsere Gäste auch an die Abmachung gehalten hatten, wegen der großen Brandgefahr auf das Rauchen zu verzichten. Meine Mutter bat mich mitzugehen. Im Beisein eines Kindes so meinte sie wäre mein Vater sicherer vor eventuellen Übergriffen.
Als wir den Holzschuppen betraten, bot sich uns im Schein der Laterne ein Bild, das ich bis heute nicht vergessen habe: Da hatte sich ein Teil der Männer unserer Sägen bemächtigt und sie schnitten nun die schweren Stämme, die hier als Brennholz lagerten, in Ofenlänge durch. Die anderen spalteten die klobigen Klötze mit dem Beil zu handlichen Scheiten und stapelten sie auf. Das alles bereitete ihnen ein sichtliches Vergnügen, umso mehr, als sie nun unsere ungläubigen und erstaunten Blicke sahen. Sie erklärten, das sei nur ein kleiner Dank für die freundliche Aufnahme.
Am anderen Morgen sind sie dann nach einem guten Frühstück nicht ohne ein großes Butterbrotpaket, das jeder von ihnen zum Abschied in die Hand gedrückt bekam weitergezogen, einer ungewissen Zukunft entgegen.
Viele Jahre sind seitdem ins Land gegangen, doch immer wieder muß ich an jenen Dezemberabend denken, an dem die Angst, die Voreingenommenheit und das Mißtrauen besiegt wurden durch ein wenig Menschenfreundlichkeit.
»Willis Heimkehr« von Ernst Haß
Walsrode in der Lüneburger Heide, Landkreis Soltau Fallingbostel, Niedersachsen, Weihnachten 1950. Einer der Transporte, die nach dem Krieg bis weit in die fünfziger Jahre hinein Rußlandheimkehrer über das Lager Friedland nach Deutschland zurückbrachten, erreichte im Dezember 1950 Walsrode. Ich war zu diesem Zeitpunkt in der dortigen Landeskrankenanstalt (LKA) beschäftigt. Von meinem Arbeitsplatz in der Telefonzentrale aus konnte ich am ersten Weihnachtstag unsere ehemaligen Ostfrontsoldaten beim Aussteigen beobachten, überwiegend Männer von 40 bis 45 Jahren, aber auch einige jüngere. Etliche waren so stark abgemagert, sie hätten wohl zweimal in die Wattejacken hineingepaßt, die sie zur Entlassung erhalten hatten. Sie schienen sehr müde und auch psychisch am Ende zu sein. Die Augen dieser Männer waren leer.
Nun standen sie da und wußten nicht recht, wie es weitergehen sollte. Daß sie hier keiner anschrie und über sie bestimmte, daß sie keine Plennys Gefangene mehr, sondern frei waren, hatte wohl noch keiner richtig begriffen. Vielleicht warteten sie auf ein Kommando?
Statt dessen erschienen unsere Krankenschwestern und brachten alle Heimkehrer in die große Turnhalle, die man als Notunterkunft vorsorglich gut geheizt und mit Matratzen und Wolldecken ausgelegt hatte. Hier erhielten die Heimkehrer zu essen und zu trinken. Unsere Ärzte untersuchten sie anschließend.
Jahrelang hatten diese Männer in Rußland kein Weihnachten mehr erlebt. Viele weinten. Fragen nach den Familienangehörigen tauchten auf. Ich hatte in der Telefonzentrale plötzlich reichlich zu tun. Alle wollten mit ihren Verwandten telefonie ren. Die Mädchen in der Telefonzentrale der Post in Walsrode waren einmalig, sie brachten die tollsten Verbindungen zustande. Ich wurde Zeuge dieser Gespräche, ob ich wollte oder nicht. So erlebte ich viel Freude, viel Kummer und Leid mit.
Ein noch jung aussehender Heimkehrer stellte sich vor: Willi Mußmann sei sein Name. Ob er telefonieren dürfe?
»Natürlich«, sagte ich. Nach kurzer Zeit hatte ich die Verbindung hergestellt. Auf der anderen Seite meldete sich eine Männerstimme: »Tischlerei Mußmann, guten Tag.«
Ich stellte mich als Mitarbeiter der LKA Walsrode vor und fragte vorsichtig: »Sind Sie der Vater von Willi Mußmann?«
»Ja, der bin ich, aber was soll das? Mein einziger Sohn ist seit 1944 verschollen.«
Ich antwortete freudig: »Das stimmt nicht, Herr Mußmann. Ihr Sohn steht hier neben mir und will mir den Hörer aus der Hand reißen. Ich übergebe das Gespräch!«
Nach einer Weile reichte mir der Mann den Hörer ganz verstört zurück: »Mein Vater sagte, daß sein Sohn Willi nicht mehr lebt und meint, daß ich ein Betrüger sei. Aber ich lebe doch noch! Was soll ich nur machen?«
Er weinte und mir kamen auch schon die Tränen. Es war schlimm. Schließlich konnte ich ihn beruhigen und ließ ihn erzählen. Er sprach von seiner Kindheit in Winsen, von seiner Schwester Änni, die eines Tages vom #Apfelbaum herunterfiel. Er bekam Schläge, weil er als älterer Bruder hätte aufpassen müssen. Wir unterhielten uns etwa eine halbe Stunde. Danach schien mir sicher, daß dieser Willi Mußmann echt und kein Betrüger sei. Wie konnte ich ihm nur helfen?
Zunächst schickte ich ihn in die Turnhalle zurück: »Du bekommst von mir Bescheid, beruhige dich erst einmal!«
Ich überlegte eine Weile und entschloß mich, nochmals bei Mußmanns anzurufen. Jetzt meldete sich auf der anderen Seite eine Frauenstimme: »Hier Tischlerei Mußmann!«
Sicher hatte mein Anruf für Aufregung gesorgt und so versuchte ich, die Wogen wieder zu glätten. Sie sagte: »Ja, das hat wirklich eine ziemliche Aufregung ins Haus gebracht. Vater war sehr aufgebracht, hat geschimpft und mehrfach ›Betrüger!‹ gerufen. Was ist denn überhaupt los?«
Ich fragte sie, ob sie die Schwester von Willi Mußmann sei, was sie bestätigte. Nun erklärte ich wie schon beim ersten Telefonat den Grund meines Anrufs. Aber auch sie zweifelte noch daran, daß es sich hier wirklich um ihren verlorengeglaubten Bruder handelte. Wir überlegten gemeinsam, wie sich die Familie Gewißheit verschaffen könne und vereinbarten, daß sie mit ihren Eltern nach Walsrode kommen sollte. Den Bruder informierte ich nicht über diese Absprache, es sollte eine Überraschung sein. Falls es sich um einen Betrüger handelte, würde man ihn anzeigen.
Zu Hause sprach ich mit meiner Frau darüber. Wir waren gespannt, wie diese Geschichte ausgehen würde.
Am nächsten Morgen, es war der 2. Weihnachtstag, stellte sich gegen 10 Uhr die Familie Mußmann bei mir in der Telefonzentrale ein. Gemeinsam mit Eltern und Tochter ging ich hinüber zur großen Turnhalle, wo die 60 Heimkehrer untergebracht waren. Beim Hineingehen gab ich den traurigen Zustand der Heimkehrer zu beden ken. Wir waren noch keine zwei Minuten in der Halle, als der junge Mußmann auf sprang. Er lief auf uns zu und rief dabei »Änni, Änni!"
Bruder und Schwester fielen sich in die Arme. »Mein Willi, mein Willi …« brachte Änni hervor. Sie umarmten und küßten sich, beide weinten vor Freude. Ihren Eltern sagte Änni: »Mama und Papa, das ist unser Willi!«
Ich beobachtete die beiden. Sie standen da wie versteinert und sahen regungslos zu. Wollten sie nicht wahrhaben, daß dieser Mann ihr Sohn war? Auf meine Fragen antworteten die Eltern: »Das ist nicht unser Sohn. Unser Willi hat anders ausgesehen. Er war viel kleiner und von schmächtiger Gestalt, dieser Riese ist ein Schwindler!«
Wie ich inzwischen wußte, war Mußmanns Sohn mit 16 Jahren freiwillig zum Volks sturm gegangen. Damals war er 1,62 m groß und wog keine 50 Kilo. Willi geriet in russische Gefangenschaft. Die schwere Arbeit in einem sibirischen Bergwerk hatte ihn körperlich verändert. Der damals noch nicht ausgewachsene Junge hatte jetzt breite Schultern und eine stattliche Größe von 1,83 Metern,
Als Willi nun auf seine Mutter zuging, um sie in den Arm zu nehmen, wehrte diese ab und sagte: »Sie sind nicht mein Sohn. Sie sind ein Betrüger!«
Beide Eltern schüttelten den Kopf. Diese Dramatik es war fürchterlich! Es ging auch mir unter die Haut! Ich glaubte, die Zeit stünde still. Als der Vater nun auch noch meinte: »Nein, das ist nicht unser Junge!« war das Maß für mich voll. Ich mischte mich wieder ein und sagte: »Kommen Sie bitte mit, damit wir andernorts darüber verhandeln können.«
Willi Mußmann stand mit seiner Schwester im Arm ganz verstört da. Änni beharrte: »Ohne Willi gehe ich hier nicht weg, komme was will!« Sie klammerte sich an ihren Bruder.
Nun redete die Mutter auf Änni ein: »Komm, mein Kind. Er ist nicht dein Bruder!«
»Doch Mama, er ist es. Gerade hat er mir erzählt, wie ich damals vom Apfelbaum gefallen bin und wie Papa ihn verhauen hat. Er weiß auch, wo wir im Garten immer am liebsten gespielt haben!«
Es lag eine ungeheure Spannung in der Luft, und viele Heimkehrer standen schon um uns herum. Ich konnte die Eltern einfach nicht verstehen. Man muß doch sein eigenes Kind wiedererkennen, dachte ich.
Endlich stellte die Mutter Fragen an ihn, die nur ihr einziger Sohn beantworten konnte. Plötzlich wurde sie schneeweiß im Gesicht und fiel in Ohnmacht. Willi konnte seine Mutter gerade noch auffangen. Er küßte sie und sie kam wieder zu sich. »Er ist es, er ist es! Er ist mein Willi!« rief sie glücklich und legte ihre Arme um seinen Hals.
Der Vater stand immer noch ungläubig dabei und stellte seinerseits Willi nun Fragen. Wo er in der Werkstatt am liebsten gespielt, an welchen Holzstützen er immer Nägel mit dem kleinen Hammer hineingeschlagen habe?
Als Willi dies alles richtig beantworten konnte, wischte der Vater sich mit der Hand über die Augen und gab zu: »Mudder, das ist doch unser Junge! Herrgott ich danke dir, daß du uns unseren Sohn zurückgegeben hast!«
Er nahm seinen Sohn in den Arm, Willi hielt seine Mutter dabei fest umklammert. Änni weinte und lachte gleichzeitig vor Glück.
Während ich dies schreibe, erlebe ich alles noch einmal die innere Anspannung, die heftigen Gefühle. Ich sehe die Mußmanns noch vor mir, wie sie alle vier glücklich die Halle verlassen. Sie ließen sich die Entlassungspapiere geben und nahmen den jungen Mann gleich mit nach Hause.
Am anderen Tag meldete sich Willi Mußmann noch einmal telefonisch bei mir. Ob er etwas vergessen habe, fragte ich. »Ja, ich habe gestern vor lauter Glück vergessen, mich von Ihnen zu verabschieden, auch Dankeschön zu sagen! Ich bin so glücklich, wieder zu Hause zu sein. Vielen Dank für Ihre Hilfe! Alles Gute für Sie und Ihre Familie. Und einen guten Rutsch ins neue Jahr!«
Ich freute mich mit ihm. Damals war ich 37 Jahre alt und Willi Mußmann nach 5 jähriger Gefangenschaft 21. Heute müßte er also 72 oder 73 Jahre alt sein! Vielleicht führen seine #Kinder die #Tischlerei weiter, und es meldet sich immer noch jemand mit »Tischlerei Mußmann, guten Tag«?
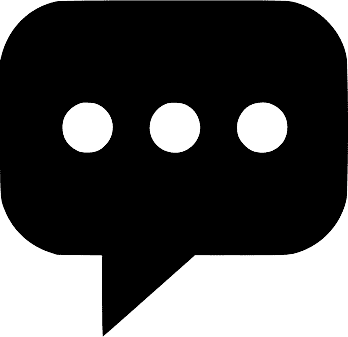
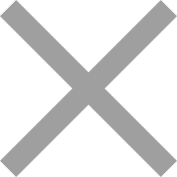

























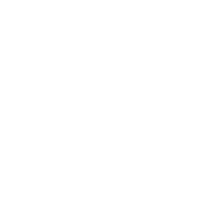
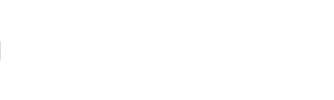









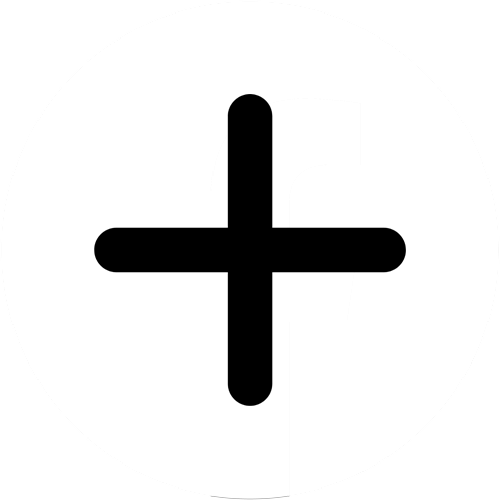
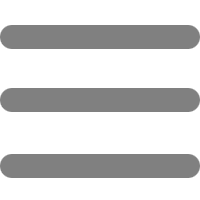

 Gütsel RSS Feed
Gütsel RSS Feed